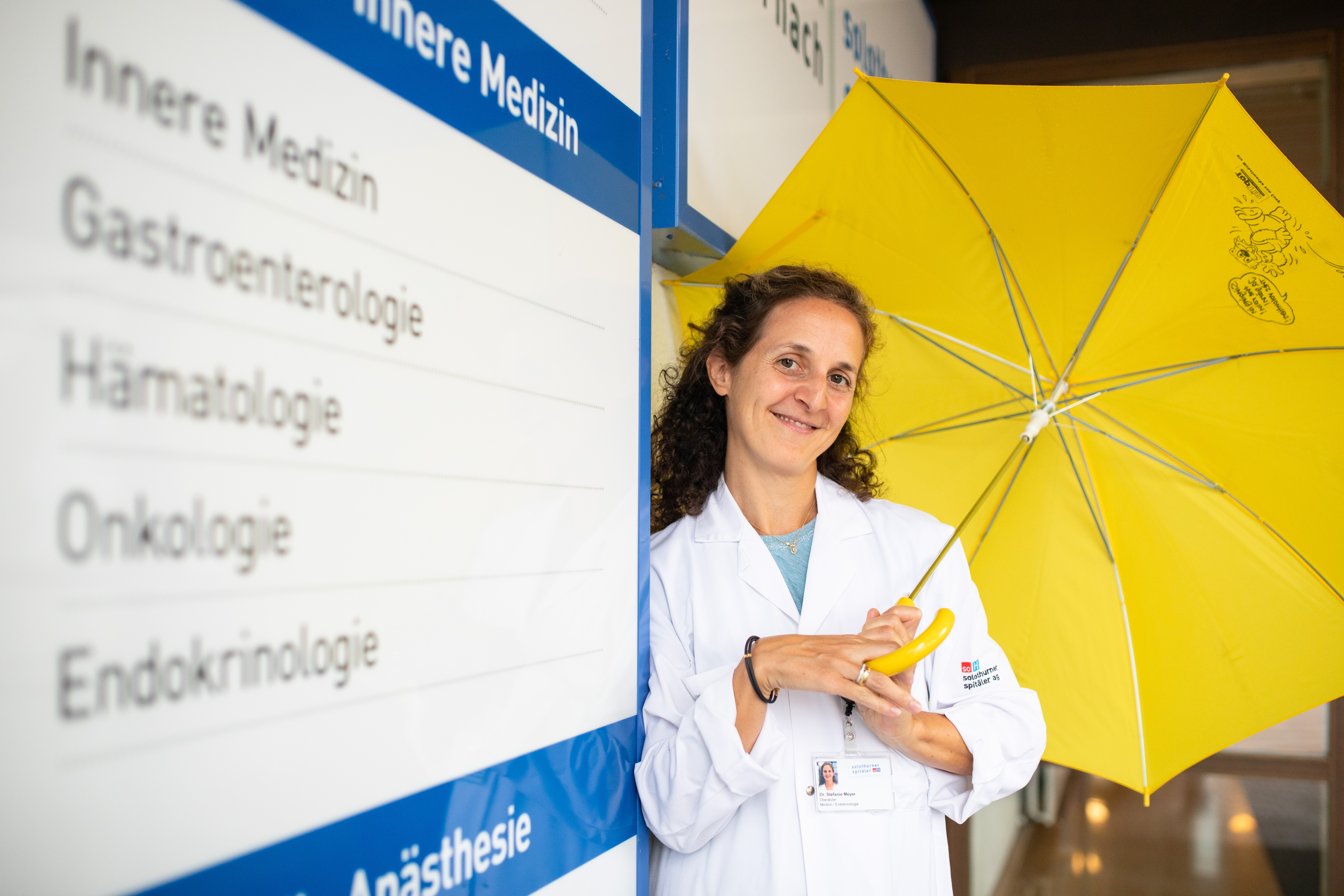Mehr Zeit für den Patienten

LEAN HOSPITAL
Mehr Zeit für den Patienten
Lean Management, sogenanntes schlankes Management, ist im Moment in aller Munde. Auch in den Solothurner Spitälern. Mit grossem Erfolg. Auf Stationen, die bereits nach Lean Management arbeiten, erhöhten sich die positiven Rückmeldungen der Patienten.
Die Notwendigkeit wurde bereits vor fünf Jahren mit dem Start des Neubaus gegeben. Im neuen Spital werden die Wege doppelt so lang und die Stationen durch die Zusammenlegungen doppelt so gross sein. Darauf vorbereiten kann man sich in der Pflege nur, indem man die Abläufe, also die Prozesse, überdenkt, analysiert und wo nötig ändert. Bei allen Überlegungen stand dabei der Patient im Zentrum. Daraus resultierte Lean Management oder Lean Hospital, wie die Umsetzung in den Spitälern genannt wird. Das Lean Hospital orientiert sich an sechs Grundsätzen (siehe rechte Seite). Dass die Begriffe japanisch klingen, kommt nicht von ungefähr, denn als Musterbeispiel für Lean Management gilt nach wie vor der japanische Automobilhersteller Toyota.
Von unten nach oben
«Wir realisierten sehr rasch, dass wir der Pflege nicht einfach ein neues System überstülpen konnten, sondern dass der Prozess von der Basis herkommen muss», sagt Dieter Hänggi, Leiter Pflegedienst des Bürgerspitals Solothurn. Er ist zusammen mit Projektleiter Fabio De Nardis verantwortlich für die Einführung von Lean Hospital. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern definierten sie Massnahmen, wie Pflegende mehr Zeit beim Patienten verbringen können. Analysiert wurden auch Tätigkeiten wie Trinken und Essen servieren, Medikamente richten, Verbandsmaterial auffüllen, Betten anziehen und anderes. «Jeder soll das tun, was sie oder er am besten kann – Logistik etwa ist zum Beispiel keine Kernaufgabe der Pflege», so Dieter Hänggi.
Perfekt ist man nie
Danach wurde diskutiert, was im Alltag gut funktioniert, was weniger. «Kaizen» wurde eingeführt. Alle am Prozess Beteiligten sollen und dürfen ihre Meinung einbringen, auch Auszubildende im ersten Lehrjahr. «Gerade die Mitarbeitenden an der Basis haben oft die besten Ideen, da sie stark im Prozess eingebunden sind», so Dieter Hänggi. Aber perfekt ist ein System nie, so die Philosophie, deshalb finden «Kaizen» weiterhin regelmässig statt.
Austausch ist wichtig
An den Huddles, den täglichen Meetings (siehe Kasten), tauscht sich das gesamte Behandlungsteam untereinander aus. «Der Huddle funktioniert als neue Form der Kommunikation», so Dieter Hänggi. Jede und jeder hat dabei ein Mitspracherecht. Das Ergebnis verblüfft. «Wir haben weniger Patientenbeschwerden, wir haben weniger Überstunden von Pflegefachpersonen und wir haben weniger Stellenwechsel, weil wir eine höhere Arbeitszeitflexibilität bieten können», so Fabio De Nardis. Und vor allem: «Wir haben noch keine einzige Rückmeldung von einem Team erhalten, das sich wieder die alten Prozesse zurück wünscht.»
Station 2 G, 10.00 Uhr, «chöi mer huddle?»
Kontesa Ademi Jakupi, stellvertretende Stationsleiterin der chirurgischen Abteilung, steht im Stationszimmer vor dem Huddle-Board, einer weissen Tafel. Es sind Newsmeldungen zu lesen, es gibt Smileys für Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit, die Koordinaten aller Stationsärzte. Rechts daneben die Tagesplanung mit der Übersicht aller Patienten auf der Station 2 G. Wo sich früher Pflegende bis zu 50 Prozent ihrer Arbeitszeit aufhielten, herrscht heute Leere.
Lean Management bedeutet auch, dass die Pflege mobil arbeitet. Das spart Wegzeit, die direkt dem Patienten zugute kommt. Kontesa Jakupi ruft «chöi mer huddle?». Die vier Bezugspflegenden erscheinen, gehen routiniert die Patientinnen und Patienten durch, die Pausenplanung, es wird geklärt, welche Pflegende noch Kapazitäten hat. Nach fünf Minuten ist der morgendliche Huddle bereits fertig, alle wissen, wer woran arbeitet. Bis zum Umzug in den Neubau Bürgerspital Solothurn, so das Ziel, werden alle Bettenstation auf Lean Management umgestellt sein.
In diesem Beitrag erklären Ihnen die Mitarbeitenden, wie Lean Management funktioniert.
Weitere Beiträge
Spital der Zukunft,Neue Behandlungskonzepte
Gebündeltes Know-how
In grösseren Spitälern gibt es immer mehr Behandlungszentren. Auch am Spital Dornach wird das Behandlungsangebot ausgebaut und vernetzt.
Spital der Zukunft,Neue Behandlungskonzepte
Stetig präziser
Die Entwicklung der modernen Medizin macht auch vor dem Operationssaal nicht halt. Im Kantonsspital Olten werden zahlreiche Eingriffe bereits mit dem Operationsroboter da Vinci Xi durchgeführt. Und im Neubau des Bürgerspitals Solothurn werden gewisse Eingriffe im sogenannten Hybrid-Operationssaal vorgenommen werden.
Spital der Zukunft,Neue Behandlungskonzepte,Gebäude und Technik
Die Digitalisierung wird die Medizin stark verändern
Spitäler nehmen heute einen wichtigen Part in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ein, und sie werden es auch in Zukunft. Ihre Rolle aber wird sich vermutlich verändern. Professor Urs Brügger, Direktor des Departements Gesundheit an der Berner Fachhochschule, über die Entwicklung der Spitäler in der Schweiz.
Der Chirurg an der Konsole

KANTONSSPITAL OLTEN: OPERIEREN MIT SYSTEM
Der Chirurg an der Konsole
Seit mehr als eineinhalb Jahren werden im Kantonsspital Olten Eingriffe mit dem Operationsroboter da Vinci Xi durchgeführt. Die Bezeichnung «Roboter» kann aber in die Irre führen.
Bei minimalinvasiven Operationen kommt immer häufiger das Operationssystem da Vinci Xi zum Einsatz. Bei diesem Verfahren sitzt der Chirurg neben dem Patienten an einer Konsole neben dem Operationstisch und bedient die Instrumente, die über kleine Bauchschnitte in den Körper eingeführt werden. Über eine hochauflösende Kamera erhält der Operateur ein dreidimensionales Bild vom Körperinneren und kann sämtliche Bewegungen mit Ruhe und ohne Zittern ausführen.
Immer mehr Operationsroboter
In den USA sind roboterassistierte Operationen bereits Standard. Aufgrund der guten Behandlungsergebnisse setzt sich diese Operationsmethode immer mehr auch in Europa durch.
Der Begriff «Roboter» darf jedoch nicht missverstanden werden – denn die robotergeführten Instrumente führen keinen einzigen Schritt selbständig aus, sondern werden immer durch den Chirurgen geführt. Die langjährige Erfahrung des Chirurgen kann beim roboterassistierten Operieren nicht ersetzt werden.
Sehr hohe Beweglichkeit
Für Dr. med. Thomas Forster, Leitender Arzt Urologie der Solothurner Spitäler, liegt der grosse Vorteil des Systems in der Beweglichkeit der Instrumente: «Die da-Vinci-Instrumente kann ich exakt wie eine menschliche Hand bewegen – das ist mit der herkömmlichen Laparoskopie nicht möglich.» Prof. Dr. med. Ulrich Dietz, verantwortlich für das da-Vinci-Xi-Programm am Kantonsspital Olten, ergänzt, dass der Roboter auch unbequeme Positionen problemlos über längere Zeit ruhig halten könne. «Jeder Schritt eines Eingriffs kann so enorm präzise durchgeführt werden».
Weitere Beiträge
Spital der Zukunft,Neue Behandlungskonzepte
Der Chirurg an der Konsole
Seit mehr als zwei Jahren werden im Kantonsspital Olten Eingriffe mit dem Operationsroboter da Vinci Xi durchgeführt. Die Bezeichnung «Roboter» kann aber in die Irre führen.
Spital der Zukunft,Neue Behandlungskonzepte
Agieren, bevor es eskaliert
Aggression und Gewalt gegen das Spitalpersonal nehmen zu. Am meisten betroffen davon sind Mitarbeitende der Notfallstationen. Am Kantonsspital Olten betreibt man deshalb seit einigen Jahren ein Deeskalationsmanagement – mit Erfolg.
Spital der Zukunft,Neue Behandlungskonzepte
Steigende Herausforderungen
Wer postet schon ein Selfie aus der Psychiatrie? Wer schwärmt vom Aufenthalt in der Klinik? Natürlich niemand. Aber wieso eigentlich nicht?
Alle Mitarbeitenden sind gefordert

3 FRAGEN AN DIE PROJEKTLEITERIN UMZUG
Alle Mitarbeitenden sind gefragt
Monika Hagi ist Projektleiterin Umzug für das neue Bürgerspital Solothurn. Doch wie organisiert man den Umzug eines Spitals?
Monika Hagi, zügeln ist Ihr Beruf, aber wie sieht es privat aus? Sind Sie schon oft umgezogen?
Nein, es gefällt mir sehr, wo ich wohne. Einzig die Wohnung haben mein Partner und ich gewechselt und verkleinerten von 180 Quadratmetern Wohnfläche auf 80 Quadratmeter. Das heisst, wir mussten uns sehr darauf fokussieren, was wir mitnehmen wollten und was nicht. Mit dem Umzug hat für uns ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Das ist im Spital nicht anders. Mit dem Umzug in den Neubau Bürgerspital Solothurn ändern sich zahlreiche Prozesse, Stationen werden zusammengelegt. Wir zügeln also nicht einfach das jetzige Spital, sondern beginnen etwas Neues.
Sie zügeln ein Spital im Vollbetrieb. Kann man so etwas überhaupt bis ins letzte Detail vorbereiten?
Wir sind ein Planungsteam von fünf Personen, beim Umzug selbst sind alle Mitarbeitenden gefordert. Ausserdem haben wir für den Umzug selbst 200 externe Personen, die uns unterstützen. Wir haben 100 Prozent als Ziel ,und wenn wir 80 Prozent in der Umsetzung erreichen, haben wir gut gearbeitet. Wir erstellen zurzeit eine Risikoanalyse für jeden möglichen Fall, der eintreten könnte. Und wir werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgängig schulen, wie sie im neuen Spital arbeiten werden. Nicht zu früh, sonst werden Details wieder vergessen, aber auch nicht zu spät. Meine Erfahrung lehrt mich auch, Ruhe zu bewahren und zu wissen, dass kurz vor dem Umzug der allergrösste Effort erfolgen wird.

Monika Hagi, Projektleiterin Umzug, hat Erfahrung mit dem Umzug von Spitälern. Sie organisierte den Umzug des Triemlispitals und war beratend beim Umzug des Spitals Wattwil dabei. Privat reist sie sehr gerne und lebt zwischendurch auch mal im Wohnmobil.
Wann ist der Umzug für Sie erfolgreich?
Wenn jede Patientin, jeder Patient schnell und sicher ins neue Spital wechseln konnte. Das Wichtigste ist, dass die Sicherheit gewährleistet ist und Patienten ab dem ersten Tag nach dem Umzug betreut und behandelt werden können. Schön wäre es auch, wenn in der Umzugswoche im Juni 2020 die Besucherinnen und Besucher jeweils erst am späteren Nachmittag ihre Angehörigen besuchen.
Weitere Beiträge
Spital der Zukunft,Gebäude und Technik
Den Patienten im Fokus
Im Juni 2020 wird der Neubau Bürgerspital Solothurn in Betrieb genommen. Das neue Gebäude ist mehr als nur eine neue Hülle – es ist die Antwort auf die medizinische Versorgung in der Zukunft. Weg vom Krankenhaus hin zum Haus für Gesundheit.
Spital der Zukunft,Gebäude und Technik
Schweizweites Pionierprojekt
Der Neubau Bürgerspital Solothurn ist schweizweit das erste Spital, das nach den strengen Kriterien von Minergie-Eco gebaut wird. Eine Pionierleistung, die wenig mehr kostet und viel mehr spart.
Spital der Zukunft,Gebäude und Technik
Viel mehr als ein Bettenhaus
Ein Spital zu bauen ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Nicht nur, weil das Gebäude unzählige Anforderungen an medizinische Standards erfüllen muss, sondern auch, weil man bereits beim Planen 40 Jahre nach vorne blicken muss.
Sterile Atmosphäre ist unerwünscht

INNENRÄUME IM NEUBAU BÜRGERSPITAL
Sterile Atmosphäre ist unerwünscht
Wie in allen neu gebauten oder sanierten Schweizer Spitälern hat auch der Neubau Bürgerspital Solothurn nur noch Ein- und Zweibettzimmer. Das entspricht nicht nur einem Bedürfnis der Patienten, sondern ist auch effizienter und sicherer.
Im Vergleich zu skandinavischen Ländern gibt es in Schweizer Spitälern insgesamt immer noch einen tiefen Anteil an Einbettzimmern. Patientinnen und Patienten genesen jedoch meist rascher, wenn sie in Ein- oder Zweibettzimmern liegen, so wie sie im Kantonsspital Olten bereits seit Jahren Realität und im Neubau Bürgerspital Solothurn geplant sind. Eine kürzlich publizierte Studie belegt zudem, dass Patienten in Mehrbettzimmern mehr Infektionen während des Spitalaufenthaltes erleiden als Patienten in Einbettzimmern. Aber auch effizientere Prozesse stehen im Vordergrund.
Wohnliche Atmosphäre ist wichtig
Viel diskutiert wurde der Bodenbelag auf den Bettenstationen. «Unser Ziel war es, ein Spital zu bauen, welches nicht mehr steril wirkt», sagt der Projektleiter des Hochbauamts Solothurn, Alfredo Pergola. Deshalb wurden auf den Bettenstationen Parkettböden aus Holz verlegt. Das Parkett wurde durch Fachinstitute mehrfach auf hygienetechnische Anforderungen geprüft und genügt allen Anforderungen. «Vergleichen wir zudem die Lebenszykluskosten, so ist der Parkettboden sogar günstiger als ein Bodenbelag aus Linoleum», so Alfredo Pergola. Zum guten Raumkonzept gehören übrigens auch eine ausgeklügelte Farbgebung und die rechtwinklige Bettenstellung.
Wie duschen?
Noch mehr Planungsfragen gab es jedoch bei den Nasszellen in den Patientenzimmern. «Einerseits sind da die strengen Vorschriften bezüglich Behindertengleichstellungsgesetz, die wir selbstverständlich erfüllen wollen und müssen, dann sollen sich Patienten gut zurechtfinden können, und als Drittes müssen die Pflegenden gut darin arbeiten können», sagt Urs Studer, Projektleiter Neubau bei den Solothurner Spitälern. Viele Ansprüche für einen kleinen Raum. Das Resultat ist sehr zufriedenstellend.

Weitere Beiträge
Spital der Zukunft,Gebäude und Technik
Sterile Atmosphäre ist unerwünscht
Wie in allen neu gebauten oder sanierten Schweizer Spitälern hat auch der Neubau Bürgerspital Solothurn nur noch Ein- und Zweibettzimmer. Das entspricht nicht nur einem Bedürfnis der Patienten, sondern ist auch effizienter und sicherer.
Spital der Zukunft,Gebäude und Technik
Den Patienten im Fokus
Im Juni 2020 wird der Neubau Bürgerspital Solothurn in Betrieb genommen. Das neue Gebäude ist mehr als nur eine neue Hülle – es ist die Antwort auf die medizinische Versorgung in der Zukunft. Weg vom Krankenhaus hin zum Haus für Gesundheit.
Spital der Zukunft,Neue Behandlungskonzepte,Gebäude und Technik
Die Digitalisierung wird die Medizin stark verändern
Spitäler nehmen heute einen wichtigen Part in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ein, und sie werden es auch in Zukunft. Ihre Rolle aber wird sich vermutlich verändern. Professor Urs Brügger, Direktor des Departements Gesundheit an der Berner Fachhochschule, über die Entwicklung der Spitäler in der Schweiz.
Die Digitalisierung wird die Medizin stark verändern

SPITAL DER ZUKUNFT
Die Digitalisierung wird die Medizin stark verändern
Spitäler nehmen heute einen wichtigen Part in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ein, und sie werden es auch in Zukunft. Ihre Rolle aber wird sich vermutlich verändern. Professor Urs Brügger, Direktor des Departements Gesundheit an der Berner Fachhochschule, über die Entwicklung der Spitäler in der Schweiz.
Urs Brügger, wie sieht die ideale Spitalversorgung der Zukunft aus?
Idealerweise gäbe es eine bessere Koordination in Gesundheitsregionen mit einer Bevölkerung von ein bis zwei Millionen Einwohnern. Im Zentrum würde ein Universitätsspital stehen für die hochspezialisierte Versorgung. Darum herum gäbe es ein Netz von kleineren Spitälern, die sich auf gewisse Leistungen spezialisieren und dadurch wirtschaftlich und in guter Qualität arbeiten können. Die Grundversorgung in den Regionen, die heute noch teilweise stationär durchgeführt wird, wird noch stärker ambulant werden, und es werden medizinische Versorgungszentren für Notfallversorgung und die Versorgung von chronisch Kranken entstehen. Insgesamt wird es weniger Spitalbetten brauchen, trotz Bevölkerungszunahme und Alterung.
Früher gab es das Sprichwort «Jedem Täli sein Spitäli», im Kanton Solothurn wurden in den vergangenen Jahren mehrere Standorte geschlossen oder zusammengelegt. Wo stehen wir in der Spitalplanung schweizweit?
Es gibt inzwischen einen gewissen Trend zu mehr Koordination und Konzentration in der Spitalversorgung. Leider gehen diese Bemühungen oft nicht über die Kantonsgrenzen hinaus. Doch eine Spitalversorgung sollte aus Gründen von Qualität und Wirtschaftlichkeit regional und nicht kantonal gedacht werden. Sie sollte sich zudem an den Patientenbedürfnissen und den Patientenströmen orientieren. Die Vorgaben im Rahmen der interkantonalen Koordination der hochspezialisierten Medizin HSM und Vorgaben von Mindestfallzahlen, die mehr und mehr in der kantonalen Spitalplanungen eingesetzt werden, unterstützen diese Entwicklung zu mehr Koordination und Konzentration.
Und wo stehen wir in 40 bis 50 Jahren, wenn die Lebensdauer der jetzigen Spitäler erreicht ist?
Voraussichtlich werden dann tendenziell vor allem noch hochspezialisierte Leistungen stationär angeboten werden. Die übrige Gesundheitsversorgung wird hauptsächlich im ambulanten Setting oder zu Hause stattfinden – «hospital at home». Doch 40 bis 50 Jahre sind ein sehr langer Zeithorizont, über den sich nur schwer eine zuverlässige Prognose machen lässt. Zudem wird die Digitalisierung die Medizin stark verändern.

Zur Person
Prof. Dr. Urs Brügger studierte Volkswirtschaftslehre und Soziologie an der Universität St. Gallen. Zudem absolvierte er noch ein internationales Master-Programm in Health Technology Assessment. Von 2003 bis Ende 2017 leitete er das Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie (WIG) an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW). Seit Januar 2018 ist Urs Brügger an der Berner Fachhochschule als Direktor des Departements Gesundheit tätig. Seine Themenschwerpunkte in Forschung und Lehre sind Health Technology Assessment (HTA), Vergütungssysteme, Gesundheitskosten und Gesundheitspolitik.
Welche bahnbrechenden Innovationen könnte es in den nächsten Jahrzehnten in der Medizin geben?
Hier ist einiges im Zusammenhang mit der Digitalisierung zu erwarten. Insbesondere verbesserte Diagnostik mithilfe von Data Science und Einsatz von Robotik in Behandlung und Pflege von Patientinnen und Patienten werden die Gesundheitsversorgung stark verändern. Dadurch wird sich auch die Rolle aller Health Professionals verändern. Im Pharmasektor werden im Sinne der «personalized medicine» noch besser auf spezifische Eigenschaften von Patientinnen und Patienten ausgerichtete Medikamente entwickelt werden.
Werden Automatisierungen und Roboter irgendwann die Arbeit übernehmen?
Das ist eine umstrittene Frage, ob die Digitalisierung insgesamt Arbeitsplätze kosten wird oder nicht. Für ein innovatives Land wie die Schweiz mit einer leistungs- und konkurrenzfähigen Wirtschaft würde ich die Chancen insgesamt höher gewichten als die Risiken. Die Schweiz dürfte zwar gewisse Arbeitsplätze verlieren, aber auch viele neue gewinnen. Bezüglich Kosten dürfte sich die Digitalisierung teilweise kostendämpfend und teilweise kostentreibend auswirken. Der Saldoeffekt ist schwer vorherzusagen.
Es gibt Warnrufe, dass auch in der Schweiz irgendwann eine Zweiklassenmedizin entstehen könnte, dass derjenige, der mehr zahlt, auch die bessere Medizin erhält. Teilen Sie diese Ansicht?
Eine Zweiklassenmedizin gibt es immer. Es lässt sich nicht vermeiden, dass sich gewisse Leute Behandlungen leisten können, die der Allgemeinheit nicht zur Verfügung stehen. Wichtig ist, dass die zweite Klasse eine genügend gute Qualität aufweist. Das Gesetz sagt, dass nur Leistungen bezahlt werden, die auch wirtschaftlich sind. Die extrem teuren neuen Immuntherapien beispielsweise haben gezeigt, dass heikle Fragen auf unser Gesundheitssystem zukommen. Wann ist hier eine Grenze im Verhältnis von Kosten zu Nutzen erreicht? Mit solchen Fragen werden wir uns stärker befassen müssen. Und es wird auch Diskussionen über die hohen Preise geben, welche die Industrie unter Druck setzen.
Eine zweite Gefahr für eine Zweiklassenmedizin sehe ich aber aufgrund des Fachkräftemangels. Mit genügend Geld wird man immer eine verfügbare Ärztin oder eine Pflegeperson finden. Doch werden alle Grundversicherten den raschen Zugang haben, wenn sie ihn brauchen? Hier müssen wir sehr aufpassen und dafür sorgen, dass diese Berufe attraktiv bleiben und wir genügend Fachkräfte haben.
Wenn Sie als Patient im Spital sind, was sind Ihre Erwartungen?
Dass ich eine gute Versorgung erhalte, die sich an den Kriterien Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit orientiert. Darüber hinaus, dass ich als Mensch wahrgenommen, respektiert und bestmöglich behandelt werde. Und schliesslich, dass ich nicht lange warten muss.
Weitere Beiträge
Spital der Zukunft,Gebäude und Technik
Sterile Atmosphäre ist unerwünscht
Wie in allen neu gebauten oder sanierten Schweizer Spitälern hat auch der Neubau Bürgerspital Solothurn nur noch Ein- und Zweibettzimmer. Das entspricht nicht nur einem Bedürfnis der Patienten, sondern ist auch effizienter und sicherer.
Spital der Zukunft,Neue Behandlungskonzepte
Agieren, bevor es eskaliert
Aggression und Gewalt gegen das Spitalpersonal nehmen zu. Am meisten betroffen davon sind Mitarbeitende der Notfallstationen. Am Kantonsspital Olten betreibt man deshalb seit einigen Jahren ein Deeskalationsmanagement – mit Erfolg.
Spital der Zukunft,Gebäude und Technik
Schweizweites Pionierprojekt
Der Neubau Bürgerspital Solothurn ist schweizweit das erste Spital, das nach den strengen Kriterien von Minergie-Eco gebaut wird. Eine Pionierleistung, die wenig mehr kostet und viel mehr spart.