Magenbypass bei 149 Kilogramm

Patientengeschichte
Magenbypass bei 149 Kilogramm
Nach seiner Operation im Herbst haben wir Eugen Schmid, 54, nochmals in Trimbach zum Interview getroffen. Im Soundslide erzählt er, wie es dazu kam, wie er sich heute fühlt und was er anderen Adipositas-Betroffenen empfiehlt.
Über Eugen Schmid

Eugen Schmid hat sich verpflichtet, nach der Operation des Magenbypasses fünf Jahre lang begleitende Massnahmen wie etwa die Ernährungsberatung zu besuchen, um sein Gewicht reduzieren und halten zu können. Seine grosse Leidenschaft übrigens ist der Fussballclub BSC Young Boys.
Wir freuen uns über Ihre Kommentare zum Beitrag!
Weitere Beiträge
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
7 Fragen an Dr. med. Mussa Hamad
In der Psychiatrie gibt es beim Austritt oft Unsicherheiten. Wie schaffe ich es, im Alltag wieder Fuss zu fassen? Was tun, bei einer erneuten Krise? Wichtig sei darum, schon beim Eintritt das Austrittsziel festzulegen, so Dr. med. Mussa Hamad.
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Rascher erholt
Recovery PLUS ist ein erfolgreiches Behandlungskonzept, welches für eine rasche Erholung nach operativen Eingriffen sorgt.
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Spitalaustritt bringt Änderungen mit
Es ist ein sehr verständlicher Wunsch, dass Patientinnen und Patienten nach einem Spitalaufenthalt am liebsten wieder nach Hause möchten. Leider ist das nicht immer der Fall.
Die Tage nach dem Eingriff

Bauchoperation
Die Tage nach dem Eingriff
Nach einem operativen Eingriff im Bauchbereich müssen Patientinnen und Patienten unter Umständen mit einem veränderten Körperbild zurechtkommen. Das braucht Geduld und Zeit.
Bei einem Darmverschluss muss es schnell gehen. Wenn der Darminhalt durch eine Verschlingung des Darms oder durch ein Hindernis blockiert ist, kann es rasch lebensbedrohlich werden. In einem solchen Fall findet der Eintritt ins Spital notfallmassig statt. Plötzlich steht eine grosse Operation an, unter Umstanden wurde auch ein Tumor entdeckt. Und es gibt Situationen, in denen der Patient bei der Operation einen künstlichen Darmausgang, ein Stoma, erhalten wird.
Am Anfang kann Überforderung stehen
In einem solchen Fall kommt sehr vieles auf die Patientinnen und Patienten zu. Alles geht schnell, Patienten und ihre Angehörigen können sich nicht ausreichend darauf vorbereiten. Nun ist eine gute interprofessionelle Zusammenarbeit wichtig. Ärzteschaft, Pflege, Physiotherapie, Ernährungsberatung, Küche, Room-Service, Sozialberatung, Stomaberatung und auch die Seelsorge arbeiten als Team zusammen. Nicht selten gibt es zu Beginn ein Abwehrverhalten. Das erfordert Fingerspitzengefühl seitens der Pflege. Hierzu muss abgeklärt werden, welche Ressourcen zur Verfugung stehen, wie die Angehörigen der Patienten damit umgehen oder wie selbstständig der Patient, die Patientin noch ist.
Schmerzfrei werden
Nach der Operation treten Schmerzen auf. Damit diese den Heilungsverlauf nicht negativ beeinflussen, ist es wichtig, dass Patientinnen und Patienten ausreichend Schmerzmittel einnehmen. Daher werden sie angehalten, dass sie ja nicht auf die Zähne beissen sollen, sondern die Schmerzmittel frühzeitig verlangen. Die Pflege motiviert die Patienten aktiv dazu und sie fragt die Schmerzintensität regelmassig mit einer Skala von 0 bis 10 ab. Und nicht zuletzt spielt die Nahrungsaufnahme eine wichtige Rolle. Viele müssen nach dem Eingriff langsam wieder mit dem Kostaufbau beginnen. Das kann für Diabetiker oder Allergiker eine Herausforderung sein, aber auch für die Küche Das Auge isst mit – auch die Breikost wird attraktiv präsentiert.
Tabus überwinden
Manchmal ist bei Krebserkrankungen des Dickdarms ein künstlicher Darmausgang, ein sogenanntes Stoma, angezeigt. In vielen Fallen temporär, manchmal auch für immer. Die Darmentleerung erfolgt über eine kleine Öffnung in der Bauchdecke, an der Haut wird ein Beutel angebracht. Diese Versorgung gewährleistet das kontrollierte und saubere Entsorgen des Stuhlgangs. Es ist eine sehr diskrete Losung, andere Menschen merken nichts davon. Für Patientinnen und Patienten ist es sehr wichtig, den richtigen Umgang damit zu lernen. Am Spital Dornach gibt es dazu die Patienten dabei, eine für sie passende Versorgung auszuwählen. Die Handhabung kann mit ihr zusammen geübt werden. Oft müssen dabei auch Ekelgefühle überwunden werden. Die gute Nachricht: Mit etwas Training läuft der Wechsel des Beutels immer besser von der Hand und danach ist fast jede Tätigkeit auch mit einem Stoma möglich. Sollte es für die Versorgung zu Hause weitere Unterstützung brauchen, kann die Spitex hinzugezogen werden.
Tipps für den Heilungsverlauf
• Aktiv sein, so gut es geht. Achten Sie dabei aber auf Einschränkungen, vor allem wenn es um das Heben von Gegenständen geht.
• Beim Duschen muss die Wunde gut abgedeckt werden. Vollbäder, Schwimmbadbesuche oder Geschlechtsverkehr sind erst nach der Wundheilung möglich. Fragen Sie die zuständige Pflegefachperson.
• Weicher und regelmässiger Stuhlgang verhindert eine pressende Entleerung des Darms und schont die operierten Bereiche. Essen Sie deshalb ballaststoffreich und trinken Sie genügend.
• Die Bauchdecke bleibt auch nach der Vernarbung empfindlich. Massieren Sie das Gewebe mit einer geeigneten Hautcreme, damit es elastisch bleibt.
• Beginnen Sie früh mit der Aktivierung der Beckenbodenmuskulatur. Die Physiotherapeutin oder der Physiotherapeut zeigt Ihnen dazu Übungen.
• Steigern Sie alle neuen Belastungen nach einer Operation langsam.
Wir freuen uns über Ihre Kommentare zum Beitrag!
Weitere Beiträge
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Kinder- und Jugendpsychiatrie
Es spricht vieles dafür, manche Kinder oder Jugendliche zu Hause und nicht in einem Besprechungszimmer oder in der Tagesklinik zu behandeln. Auf Hausbesuch im Wasseramt.
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Die Sicht der Hausärztin
Im Kanton Solothurn leisten die Hausärztinnen und Hausärzte Notfalldienste im Spital – in der sogenannten vorgelagerten Notfallstation.
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
7 Fragen an Dr. med. Mussa Hamad
In der Psychiatrie gibt es beim Austritt oft Unsicherheiten. Wie schaffe ich es, im Alltag wieder Fuss zu fassen? Was tun, bei einer erneuten Krise? Wichtig sei darum, schon beim Eintritt das Austrittsziel festzulegen, so Dr. med. Mussa Hamad.
Köchin

Fragen an die Köchin
«Essen hat nicht den Stellenwert, den es verdient»
Sie wurde mit der Schweizer Juniorenmannschaft Kochweltmeisterin und kann den Salzgehalt mit der Nase riechen. Ihr Lieblingsessen ist Kartoffelgratin mit Rahm und Greyerzerkäse.
Karina Fruman, Liebe geht durch den Magen? Richtig?
Auf jeden Fall. Nach einem guten Essen geht es den meisten Menschen besser. Sie haben bestimmt auch schon mal nach dem Essen gesagt «Ah, das hat gutgetan». Wird mit Herzblut gekocht, hat das eine Wirkung. Als mein Vater krank war, kochte ich für ihn. Er meinte, das sei die beste Medizin gewesen. Heute hat das Essen leider nicht mehr den Stellenwert, den es verdient. Man sollte dem Essen wieder mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Kochen ist auch Leidenschaft.
Wie sind Sie zum Kochen gekommen?
Kochen liegt in unserer Familie. Eigentlich hatte ich bereits eine Lehrstelle als Grafikerin. Meine Grossmutter, die früher Köchin gewesen ist, überredete mich aber dazu, doch noch eine Schnupperlehre als Köchin zu machen. Ich ging eigentlich nur ihr zuliebe und war anschliessend begeistert vom Beruf. Meine Lehre machte ich in der Militärkaserne in Jassbach. Beim Militär gibt es interne Förderprogramme, die einem genügend Zeit zum Lernen lassen und auch Raum geben, einen eigenen Kochstil zu finden. Nach der Lehre folgten diverse Aufenthalte in unterschiedlichen Restaurants, seit etwas über einem Jahr arbeite ich im Kantonsspital Olten. Ich war auf der Suche nach einem Arbeitgeber, der meine Tätigkeit in der Schweizer Juniorenmannschaft im Kochen unterstützt. Das fand ich bei den Solothurner Spitälern.
Sie haben Zöliakie, vertragen also kein Gluten. Wie gehen Sie damit um?
Ich arbeite viel mit der Nase. Vor allem bei Lebensmitteln, die ich nicht vertrage. Ich rieche zum Beispiel, ob Teigwaren genügend Salz haben. Das musste ich trainieren. Ich roch, fragte einen Kollegen in der Küche, ob er probieren könne und mit der Zeit lernte ich so den Salzgehalt gewisser Gerichte riechen. Mittlerweile kenne ich auch in der Spitalküche jede Zutat auswendig, weiss, ob es Weizenkleber, Gluten, drin hat oder nicht. Kochen kann ich alles, aber wenn ich nicht unbedingt Teig kneten muss, dann gebe ich das gerne ab.
Mit der Schweizer Juniorenkochmannschaft wurden Sie Weltmeisterin und holten sogar dreimal Gold in Luxemburg 2022. Auf was kommt es da an?
Man muss bereit sein, alles zu geben und fürs Training auch sein Privatleben zurückzustecken. Am Wettbewerb selbst ist eine perfekte Vorbereitung enorm wichtig. Es muss alles organisiert sein. Denn am Ende ist es Teamwork. Beim Wettbewerb geht es nicht nur ums Essen selbst, sondern auch um den gesamten Prozess. Dabei wird das Tempo bewertet, die Hygiene, ob man viel Abfall produziert, ob viel Strom verbraucht wird, die Kommunikation im Team, die Temperaturen der Lebensmittel, die Qualität und natürlich die Konstanz. Wir mussten 70 Teller anrichten und den Testesserinnen und Testessern über mehrere Stunden dasselbe Menü in derselben Qualität servieren können. Und man sollte auch sein eigenes Land repräsentieren. Am Ende geht es auch um Innovation.
Spitalküche hingegen hat leider nicht immer einen guten Ruf. Weshalb?
Die Spitalküche hat ihren Ruf sehr zu Unrecht. Ich denke das liegt vor allem daran, dass die meisten Menschen, die hier auf den Bettenstationen liegen, unfreiwillig da sind. Man hat Schmerzen, kaum Appetit, da braucht nur was Kleines nicht zu stimmen, und schon ists nicht mehr gut. Aber auch das zeigt wieder den wichtigen Stellenwert des Essens. Auf den meisten Stationen gibt es übrigens mittlerweile Wahlmenüs. Patientinnen und Patienten können also aus verschiedenen Angeboten auswählen. Aber wissen Sie, was stets der Renner ist? Hörnli mit Ghacketem. Da wird meistens nichts anderes mehr bestellt.
Über Karina Frumann
Karina ist Köchin im Kantonsspital Olten. Sie wurde 2022 in Luxemburg mit der Schweizer Junioren Kochnationalmannschaft Weltmeisterin. Bei der Koch Meisterschaft wird nicht nur die Qualität bewertet, sondern auch die Kommunikation, die Abfallproduktion, die Innovation, das Tempo, die Hygiene und vieles mehr. Während mehrerer Stunden muss das Essen anschliessend in der gleichbleibenden Qualität angeboten werden können.
Wir freuen uns über Ihre Kommentare zum Beitrag!
Weitere Beiträge
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Patientenporträt: Leben ohne Nieren
Judith Rafael Rosa, 63, musste wegen einer Erbkrankheit ihre Nieren entfernen lassen. Vertrauen zum Arzt und die Aufforderung, sich jederzeit melden zu dürfen, gaben ihr beim Austritt Sicherheit.
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Neue Medizinstrategie soH
Die Solothurner Spitäler haben eine neue Medizinstrategie. Eines der Ziele ist, das Gesundheitsnetzwerk der Solothurner Spitäler auszubauen. Was heisst das genau?
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Direkt nach Hause
Immer mehr Patientinnen und Patienten gehen direkt in die Notfallstationen der Spitäler statt zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Rund drei Viertel der Fälle können entsprechend ambulant behandelt werden.
Patientengeschichte

Patientengeschichte
Lebenslanger Kampf gegen das Gewicht
Eugen Schmid, 54, kämpfte sein Leben lang mit dem Gewicht. Nun steht er vor einem bariatrischen Eingriff, bei dem er einen Magenbypass erhält. Er freut sich auf ein normales Leben mit weniger Kilos.
«Jetzt musste etwas passieren. Seit ein paar Monaten bin ich wegen einem Facettensyndrom krankgeschrieben. Ich habe starke Rückenschmerzen, weil meine Facettengelenke entzündet sind. Mein Hausarzt zögerte nicht lange, als ich ihm mitteilte, dass ich nun einen Eingriff am Magen vornehmen wolle und überschrieb mich direkt ans Kantonsspital Olten.
Ich war schon als Kind übergewichtig. Das liegt in der Familie. Mein Grossvater war ein ziemlicher Apparat, mein Onkel, meine Mutter und auch die Brüder. Alle haben die Tendenz zum Übergewicht. Ich hatte – abgesehen vom künstlichen Kniegelenk – bislang nie grosse Probleme wegen des Gewichts. Bis nun die starken Schmerzen am Rücken aufgetreten sind. Mein Arbeitgeber unterstützt mich. Das ist ein Glück. Seit 25 Jahren bin ich Lagerist. Eigentlich habe ich Metzger gelernt. Ich arbeitete früher einige Jahre am Schlachtband, aber da geht man kaputt daran. Irgendwann machten die Handgelenke nicht mehr mit.
Seit Jahren versuche ich immer wieder abzunehmen, aber das will einfach nicht klappen. Zwei meiner Brüder sind bereits gestorben. Nicht im Zusammenhang mit dem Übergewicht. Aber da kommt man an einen Punkt im Leben, an dem man sich überlegt, wie es weitergehen soll. Schon bald werde ich Grossvater. Mein Wunsch ist es, beschwerdefrei mit meinen Enkeln spielen zu können. Auch das ist eine Motivation für den Eingriff.»
Über Eugen Schmid

Eugen Schmid hat sich verpflichtet, nach der Operation des Magenbypasses fünf Jahre lang begleitende Massnahmen wie etwa die Ernährungsberatung zu besuchen, um sein Gewicht reduzieren und halten zu können. Seine grosse Leidenschaft übrigens ist der Fussballclub BSC Young Boys.
Wir freuen uns über Ihre Kommentare zum Beitrag!
Weitere Beiträge
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Vernetzte Zusammenarbeit Ergotherapie
In der Ergotherapie ist es unser Ziel, dass die Patientinnen und Patienten möglichst viele Aktivitäten wieder ausführen können.
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Die Sicht der Hausärztin
Im Kanton Solothurn leisten die Hausärztinnen und Hausärzte Notfalldienste im Spital – in der sogenannten vorgelagerten Notfallstation.
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Spitalaustritt bringt Änderungen mit
Es ist ein sehr verständlicher Wunsch, dass Patientinnen und Patienten nach einem Spitalaufenthalt am liebsten wieder nach Hause möchten. Leider ist das nicht immer der Fall.
Hauptnährstoffe

Hauptnährstoffe
Richtig oder nicht?
Ernährungstipps haben Hochkonjunktur, aber nicht immer sind diese wahr. Zeit, um mit ein paar Mythen aufzuräumen.
Kohlenhydrate machen dick
Dies stimmt so nicht. Entscheidend ist die Menge. Zuerst: Ohne Kohlenhydrate – sie bestehen aus Zuckermolekülen – funktioniert nichts mehr in unserem Körper. Kohlenhydrate liefern Energie für die Muskeln, aber auch für das Gehirn. Sie sind haupt- sächlich in Brot, Teigwaren, Kartoffeln, Reis, Getreideprodukten, Mais, Früchten, Kuhmilch, Joghurt oder auch in Süssigkeiten enthalten. Man unterteilt sie in Einfachzucker, Zweifachzucker und Mehrfachzucker. Stark verarbeitete Produkte wie etwa Süssigkeiten oder Weissmehlprodukte enthalten Einfach- und Zweifachzucker. Diese gelangen vom Darm schnell in den Blutkreislauf und machen nicht lange satt. Mehrfachzucker hingegen, wie er etwa in Vollkornprodukten, Gemüse oder Hülsenfrüchten vorkommt, wird langsamer abgebaut und lässt das Sättigungsgefühl länger anhalten. Dazu trägt aber auch der hohe Nahrungsfasergehalt dieser Lebensmittel bei. Kohlenhydrate können vom Körper in Glukosedepots, hauptsächlich in der Leber und den Muskeln, gespeichert werden. Für eine Gewichtszunahme sorgen Kohlenhydrate dann, wenn mehr gegessen wird, als der Körper benötigt. Die überschüssigen Kohlenhydrate werden in Form von Fett als körpereigene Reserve eingelagert.
▶ Länger sättigende Kohlenhydratarten finden sich zum Beispiel in Vollkornprodukten, Linsen, Bohnen und Getreideflocken ohne Zucker
Protein ist für den Muskelaufbau nötig
Das ist richtig. Wer zu wenig Protein (Eiweiss) zu sich nimmt, schadet dem Aufbau, aber auch dem Erhalt von Muskeln. Proteine sind zudem wichtig für den Aufbau von Knochen, Knorpeln und spielen auch bei der Zellregeneration eine Rolle. So werden Botenstoffe aus einzelnen Proteinbestandteilen (Aminosäuren) hergestellt. Protein ist zudem ein Nährstoff, welcher eine langanhaltende Sättigung begünstigt. Genügend Proteine erhält man auch bei einer ausgewogenen vegetarischen oder veganen Ernährung. Dafür sollte man sich aber zuerst vertieft mit diesen Ernährungsformen auseinandersetzen.
▶ Lebensmittel, die viel Protein enthalten: Fleisch, Fisch, Eier, Kuhmilch, Milchprodukte, Soja, Tofu, Linsen, Bohnen, Erbsen oder Nüsse.
Gute Fette, schlechte Fette
So einfach ist es nicht. Fette haben zwar einen schlechten Ruf, sind aber für die Ernährung und die Gesundheit unverzichtbar. Ausserdem machen sie als Träger von Geschmacksstoffen das Essen schmackhafter und wirken genau wie nahrungsfaser- und proteinreiche Lebensmittel sättigend. Der Körper braucht Fette für viele Vorgänge wie etwa den Aufbau von Körperzellen oder für verschiedenste körpereigene Funktionen. Fette werden in gesättigte, einfach ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren unterteilt. Gesättigte Fette kommen in Wurst, Fleisch, Käse, frittierten Speisen, Kokosöl, Butter oder vielen Fertigprodukten vor. Zwar braucht unser Körper auch gesättigte Fette, aber nicht so viel. Gesättigte Fettsäuren kann unser Körper auch selbst herstellen. Ungesättigte Fettsäuren hingegen müssen über die Nahrung zugeführt werden. Sie sind unter anderem in Nüssen, Leinsamen, kaltgepresstem Raps- und Olivenöl oder fettreichem Fisch wie Lachs vorhanden. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren, auch bekannt als Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, wirken entzündungshemmend im Körper. Diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren kommen hauptsächlich in Baumnüssen, Lein- und Chiasamen, Rapsöl und fettreichem Fisch vor. Fette ermöglichen zudem, dass der Körper die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K aufnehmen kann. Rund 30 Prozent der täglich aufgenommenen Energie sollte durch Fette aufgenommen werden. Ungesättigte Fettsäuren sind dabei vorzuziehen.
▶ Ungesättigte Fettsäuren finden sich in Nüssen, Samen, Kernen, Ölen wie Leinöl, Raps- oder Olivenöl, Avocado, Fisch.
Ernährungsberatung der Solothurner Spitäler
Die Mitarbeitenden der Ernährungsberatung unter stützen Patientinnen und Patienten unter anderem bei Mangelernährung, Stoffwechselerkrankungen, Allergien Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Aufbau nach Operationen oder Übergewicht. Dabei legen sie einen grossen Wert auf eine individuelle Betreuung. Die Überweisung erfolgt in der Regel durch die behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt.
Informationen zur Ernährungsberatung an unseren Standorten:
Wir freuen uns über Ihre Kommentare zum Beitrag!
Weitere Beiträge
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Die Sicht der Hausärztin
Im Kanton Solothurn leisten die Hausärztinnen und Hausärzte Notfalldienste im Spital – in der sogenannten vorgelagerten Notfallstation.
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Neue Medizinstrategie soH
Die Solothurner Spitäler haben eine neue Medizinstrategie. Eines der Ziele ist, das Gesundheitsnetzwerk der Solothurner Spitäler auszubauen. Was heisst das genau?
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Spitalaustritt bringt Änderungen mit
Es ist ein sehr verständlicher Wunsch, dass Patientinnen und Patienten nach einem Spitalaufenthalt am liebsten wieder nach Hause möchten. Leider ist das nicht immer der Fall.
Fünf Schritte, die helfen, Gewicht zu reduzieren

Bariatrische Chirurgie
Fünf Schritte, die helfen, Gewicht zu reduzieren
Bei schwer übergewichtigen Menschen ist eine Operation am Magen manchmal die einzige Massnahme, die zu einer Reduktion des Gewichts führen kann. Aber nie die Einzige. Bericht aus dem Operationssaal.
Ein Dienstag im August, Operationssaal 4, Kantonsspital Olten. «Guete Morge mitenand» sagt Dr. med. Urs Pfefferkorn, «wir beginnen mit dem Team-Time-out». Er erwähnt den Namen des Patienten, sein Alter und welchen Eingriff er durchführen wird. Die Angaben werden vom Team bestätigt, die Operation für einen Magenbypass kann beginnen. Über 1200 solcher Operationen haben er und sein Team in den letzten 10 Jahren bereits durchgeführt. Ein leichter Eingriff ist es dennoch nicht. Der Patient, nennen wir ihn an dieser Stelle Stefan M., ist 39-jährig und hat krankhaftes Übergewicht, er ist adipös. Adipös sein heisst nicht nur, ein paar Kilogramm zu viel auf den Rippen zu haben, sondern ist schweres Übergewicht mit einem Body- Mass-Index BMI von über 35 kg/m2. Adipositas verursacht oft Folgeerkrankungen wie Gelenkprobleme, Diabetes, Herz-Kreislauf-Probleme, aber auch ein erhöhtes Risiko für gewisse Krebsarten. «Wir kämpfen dafür, dass Adipositas wie von der Weltgesundheitsorganisation auch in der Gesellschaft als Krankheit anerkannt wird», meint Urs Pfefferkorn. Die Operation erfolgt laparoskopisch über fünf kleine Schnitte im Bauch.
Der Bauch des Patienten wird mit CO2 gefüllt, damit sich im Innern des Bauchs ein Hohl- raum bildet und die Instrumente der Chirurginnen und Chirurgen genügend Bewegungsfreiheit haben werden. Über fünf kleine Hautschnitte werden eine Kamera und die langen Instrumente in den Bauch eingeführt. Das Licht geht aus, nun blickt das Operationsteam auf zwei Bildschirme und sieht durch eine hochauflösende Kamera ins Innere des Bauchs. Urs Pfefferkorn muss immer wieder Fettgewebe umlegen, um an den Magen und den Dünndarm zu gelangen.Bevor Stefan M. sich dieser Operation unterziehen konnte, hatte er eine lange Leidensgeschichte hinter sich. «Manchmal vergessen wir», so Urs Pfefferkorn, «dass adipöse Menschen ein Stigma mit sich tragen. Sie werden in unserer Gesellschaft immer noch diskriminiert. Viele von ihnen ziehen sich dadurch zurück, was den Teufelskreis von geringem Selbstwertgefühl, Frust und Essen noch verstärkt.» Und er fügt an: «Oft heisst es, dick werde man durch mangelnde Selbstbeherrschung. Das ist falsch. Menschen werden nicht adipös, weil sie zu viel essen, sondern sie essen zu viel, weil sie Adipositas haben.»
Die Bauchdecke pulsiert mit jedem Piep des Monitors, welcher nebst Puls auch Vital- werte wie Blutdruck, Temperatur oder Sauerstoffsättigung anzeigt. Sieben Fachpersonen kümmern sich zeitgleich um den Patienten. Nebst dem Hauptoperateur Urs Pfefferkorn sind eine Leitende Ärztin, eine Oberärztin, zwei Fachfrauen Operationstechnik, ein Oberarzt Anästhesie, eine Anästhesiepflegerin und ein Fachmann für Operationslagerung im Saal 4. Urs Pfefferkorn legt im Innern des Bauchs die Operationsstelle frei und bildet aus einem kleinen Teil des Magens eine kleine Magentasche, den sogenannten Pouch. Bei jedem Schnitt im Innern des Bauchs wird die Wunde sofort mit Strom verödet, damit sich möglichst wenig Blut im Bauchinnern ansammelt. Der Restmagen wird mit Klammern verschlossen.
Seit über 40 Jahren werden bariatrische Operationen durchgeführt. Bei einem Magenbypass wird der Dünndarm so umgeleitet, dass Nahrung am Magen und Zwölffingerdarm vorbeigeleitet wird und sich erst später mit den Verdauungssäften vermengt. Zudem lässt sich durch die Magentasche nur noch ein verkleinerter Teil der Nahrung aufnehmen. Durch den Eingriff werden aber auch Hormone, die auf das Hunger- und das Sättigungsgefühl wirken, anders reguliert.
Der Monitor wird nun auf eine 3D-Sicht umgeschaltet, alle ziehen eine 3D-Brille an. Urs Pfefferkorn greift mit der Endoskopiezange den Dünndarm und misst 80 Zentimeter ab. Dann schneidet er den Dünndarm durch und näht ihn an die Magentasche. Der Magen wird so umgangen. Die Zusammenarbeit der drei Operateure geht Hand in Hand, flüssig, routiniert, sauber. Die Operationsstellen bluten nur wenig. Das Darmende wird mit der Magentasche dicht verschlossen. Da- nach wird das obere Dünndarmende an den Darm angenäht, der Dünndarm schön platziert. «Es ist wichtig, dass der Darm gut liegt», kommentiert Urs Pfefferkorn den Operationsschritt, «ansonsten das Risiko für einen Darmverschluss steigt». Am Ende wird der Bauch gespült und die Nähte auf ihre Dichtigkeit überprüft. Es zischt, wenn die Eintrittsportale für die Instrumente aus dem Bauch gezogen werden. Direkt vor der Operation musste Stefan M. während zwei Wochen eine Diät durchführen, um das Volumen der Leber zu reduzieren. Je früher damit begonnen wird, desto rascher erholen sich Patientinnen und Patienten. Damit er für eine Operation überhaupt zugelassen wurde, musste er aber noch mehr Kriterien erfüllen (siehe «Der Weg zu einer Operation»).
Die Bauchschnitte werden von innen her vernäht, die Hautschnitte von aussen, der operative Eingriff ist beendet. Voraussichtlich drei Tage wird Stefan M. nun im Spital verbringen und danach nach Hause gehen können. Richtig erholt wird er aber erst in zwei bis vier Wochen sein. Ab jetzt kann er nur noch geringe Nahrungsmengen zu sich nehmen. «Wer aber denkt, damit sei es getan, irrt sich», so Urs Pfefferkorn. Stefan M. wird immer daran arbeiten müssen, sein Gewicht zu halten. Ab jetzt beginnt jedoch ein neues Leben für ihn: Das Essen, Aussehen, Körpergefühl, die Kleidung, das Selbstwertgefühl, die Bewegung – vieles wird sich ändern. Urs Pfefferkorn ruft die Partnerin von Stefan M. an, teilt ihr mit, die Operation sei erfolgreich gewesen. Für den Patienten ein lebensverändernder Eingriff, für Urs Pfefferkorn Profession.



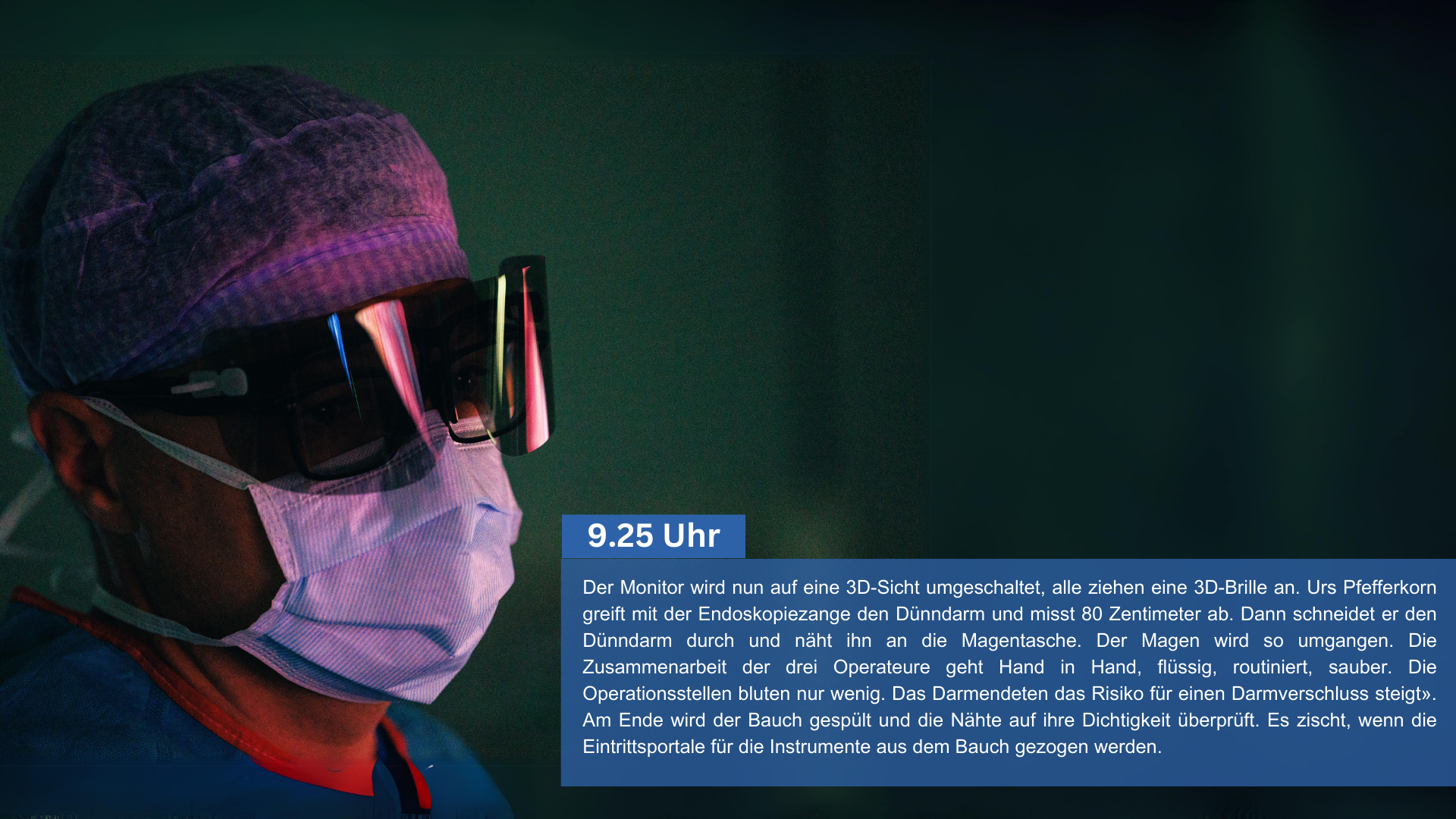

Erfahren Sie mehr über zwei Eingriffe der bariatrischen Chirurgie in den nachfolgenden Erklärvideos, bereitgestellt von Medtronic.
Wir freuen uns über Ihre Kommentare zum Beitrag!
Weitere Beiträge
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Spitalaustritt bringt Änderungen mit
Es ist ein sehr verständlicher Wunsch, dass Patientinnen und Patienten nach einem Spitalaufenthalt am liebsten wieder nach Hause möchten. Leider ist das nicht immer der Fall.
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Patientenporträt Claudia Ruther
Claudia Ruther, 52, hatte Glück im Unglück, da ihr Brustkrebs keine Metastasen bildete. Heute ist sie krebsfrei und denkt sogar gerne an die Zeit im Onkologiezentrum zurück.
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Vernetzte Zusammenarbeit Ergotherapie
In der Ergotherapie ist es unser Ziel, dass die Patientinnen und Patienten möglichst viele Aktivitäten wieder ausführen können.
Die wichtigste Eigenschaft ist Demut

Chirurgie
«Die wichtigste Eigenschaft ist Demut»
Wohin entwickelt sich die Chirurgie? PD Dr. med. Samuel A. Käser, Chefarzt Chirurgie am Bürgerspital Solothurn, über die schneidende Disziplin, Handfertigkeit und den Trend zur Spezialisierung.
Samuel Käser, ganz grundsätzlich: Was macht ein Chirurg?
Ein Chirurg heilt Erkrankungen und Verletzungen mit Eingriffen am menschlichen Körper. Da dies doch ein sehr breites Therapiefeld ist, haben sich über Jahrzehnte zunehmend Spezialbereiche innerhalb der Chirurgie entwickelt. Als Beispiel behandelt die Viszeralchirurgie Erkrankungen oder Verletzungen des gesamten Bauchraums, des Magen-Darm-Trakts, der Organe im Bauchraum, der Bauchwand, aber auch des endokrinen Systems wie die Schilddrüsen und Nebenschilddrüsen.
Welche Grundeigenschaften muss eine Chirurgin, ein Chirurg haben?
Ich würde sagen die wichtigste Eigenschaft ist Demut. Man muss die Fähigkeit haben, die Situation so zu erkennen, wie sie ist. Man muss wissen, was man kann, und man muss bereit sein, dieses Können unabhängig von den Umständen einzusetzen. Das heisst, man muss dienen können. Gleichzeitig braucht man einen gewissen Mut. Jeder Eingriff ist anders. Deswegen braucht es während eines Eingriffs immer wieder Entscheidungen. Da ein Eingriff am menschlichen Körper eine Körperverletzung darstellt, gehört trotz des Einverständnisses des Patienten eine gehörige Portion Mut dazu, eine Operation durchzuführen.
Es wird gesagt, Chirurginnen und Chirurgen brauchen eine hohe Fingerfertigkeit.
Eine gewisse Fingerfertigkeit braucht man. Aber es ist nicht das reine Handwerk, welches eine gute Chirurgin, einen guten Chirurgen ausmacht. Man muss sich sicher sein in dem, was man tut und das Richtige im richtigen Moment machen. Was Chirurgen brauchen, ist eine hohe Leistungsbereitschaft und Leidensfähigkeit. Man muss mit Leib und Seele dabei sein, ansonsten wird man den Anforderungen des Berufes nicht gerecht.
Nun gibt es den allgemeinen Trend zur Spezialisierung …
… welcher auch in der Chirurgie nicht Halt macht. Es gibt Fachärzte und Fachärztinnen für Neurochirurgie, Orthopädische Chirurgie, Plastische und Wiederherstellungschirurgie, Urologie, Handchirurgie und wie gesagt auch die Viszeralchirurgie. Ohne diese Spezialisierung wäre ein grosser Teil der medizinischen Entwicklung nicht möglich. Sorgen macht uns aber etwas anderes.
Das wäre?
An die Stelle der Eigenverantwortung zu entscheiden, was man selber kann, treten zunehmend politische Entscheidungen, die einem diktieren, was man darf. Salopp gesagt kommt es nicht mehr darauf an, was man kann, sondern was man darf. Diese Entscheidungen sind oft politisch motiviert und fachlich nicht gut begründbar.
Wie schätzen Sie das chirurgische Niveau in der Schweiz ein?
Ich habe zehn Jahre meiner Kindheit in Afrika gelebt. Deshalb ist meine Sicht auf die hiesige Welt vielleicht etwas anders. Verglichen mit anderen Industrieländern haben wir sicher ein sehr gutes
Gesundheitssystem. Der grosse Unterschied zu vielen anderen Ländern ist, dass wir der ganzen Bevölkerung die medizinisch gleiche Behandlung bieten.
Wie war es, als Sie das erste Mal zum Schnitt angesetzt hatten?
Es war ein spezielles Gefühl, die Haut eines lebenden Menschen zu durchtrennen. Das ist bis heute so geblieben. Aber nach dem Schnitt tauche ich in eine Welt ein, in der ich versinke. Ab da ist mein Fokus bei der Operation.
Die Entwicklung der Chirurgie
Bereits in der Steinzeit wurden chirurgische Handlungen vorgenommen. In den verschiedenen Weltkulturen wurde diese weiterentwickelt. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts ermöglichten die Narkose und die Hygienemassnahmen die Entwicklung der modernen westlichen Chirurgie. Weitere wichtige Entwicklungen waren die Entdeckung des Penicillins, die Etablierung der modernen Intensivmedizin und die Einführung von minimalinvasiven Methoden. Vor etwa 100 Jahren begann die Spezialisierung in eigene Fächer mit jeweils eigenen Ausbildungswegen. Diese Spezialisierung ist weiter im Gang.
Die Chirurgie am Bürgerspital Solothurn
Alle wichtigen Informationen rund um die Chirurgie finden Sie auf der Webseite des Bürgerspitals Solothurn unter Chirurgie.
Wir freuen uns über Ihre Kommentare zum Beitrag!
Weitere Beiträge
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Vom Spital bis zur Spitex
Die beste Versorgung im Spital nützt wenig, wenn die notwendige Nachsorge nach dem Spitalaustritt schlecht oder gar nicht organisiert wurde. Fünf Sichtweisen, wie eine gute Übergabe geplant sein soll.
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Patientenporträt Claudia Ruther
Claudia Ruther, 52, hatte Glück im Unglück, da ihr Brustkrebs keine Metastasen bildete. Heute ist sie krebsfrei und denkt sogar gerne an die Zeit im Onkologiezentrum zurück.
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Pflege: Bei uns laufen Informationen zusammen
Die Planung des Austritts fängt bei uns bereits beim Eintritt an. Natürlich ist es ein grosser Unterschied, ob es sich um eine betagte Person handelt, die mit einer Lungenentzündung notfallmässig eingeliefert wird, oder um einen geplanten orthopädischen Eingriff eines jungen Menschen.
Wenn der Bauch drückt

Blähungen bei Babys
Wenn der Bauch drückt
In den ersten Monaten leiden viele Babys unter Blähungen oder Bauchschmerzen. Woher die Beschwerden genau kommen, ist unklar. Aber man kann etwas dagegen tun.
Es ist eine Situation, die viele frischgebackene Eltern verunsichert: Das Baby hat gerade getrunken und schreit, obwohl es eigentlich satt sein müsste. Oft hat es in solchen Fällen Blähungen oder Bauch- schmerzen. «Gerade zu Beginn des Stillens muss man sich bewusst sein, dass der gesamte Verdauungstrakt des Babys noch nicht ganz ausgereift ist», erklärt Barbara Summer, Stillberaterin am Kantonsspital Olten. Im Bauch bekommt das Baby alles Lebenswichtige über die Nabelschnur und schluckt ausschliesslich Fruchtwasser. Beim Stillen oder auch bei Säuglingsnahrung muss der Darm sich umstellen. Das fordert den Verdauungstrakt.
Viel trinken
Warum gewisse Babys mehr Blähungen haben als andere, ist nicht bekannt. Man dachte lange, es habe ausschliesslich damit zu tun, was die stillende Mutter essen würde, sagt Barbara Summer. Das sei aber überholt: «Babys vertragen Muttermilch grundsätzlich sehr gut. Die früheren Empfehlungen, man dürfe keine Bohnen oder andere Produkte essen, die Blähungen verursachen, stimmen so nicht.» Die Mutter solle ihr Kind beobachten und wenn sie merke, dass ihr Baby vermehrt Blähungen habe, solle sie auf dieses Lebensmittel verzichten. Einzig von Salbei oder Pfefferminz wird abgeraten, da beide Kräuter abstillend wirken.
Ruhe ist wichtig
Schreit das Kind sehr viel, kann das Eltern stark verunsichern. Sie sehen, dass ihr Baby Bauchweh hat und nichts hilft. Die Stillberaterin empfiehlt, sich in solchen Fällen Hilfe oder Beratung zu holen. «Viele Eltern warten zu lange, bevor sie sich trauen, dies mit der Hebamme oder einer Stillberaterin zu besprechen.» Manchmal helfe es schon nur zu erfahren, dass man nichts falsch gemacht habe. Und dann rät Barbara Summer aber auch zur Gelassenheit: «Kinder nehmen viel mehr von der Umgebung wahr, als wir meinen. Werden die Eltern unruhig, wird auch das Kind unruhig.» Das sei zwar leichter gesagt als getan, aber sehr wichtig und beginne bereits beim Stillen. «Sich während des Stillens oder der Schoppennahrung ganz dem Baby zu widmen, sorgt bereits für Ruhe und gibt dem Baby Sicherheit.» Und übrigens: Weinen sei auch ganz normal. «Eine andere Möglichkeit hat das Kind ja noch nicht, um sich auszudrücken.»
Was nach dem Stillen hilft
- Der Fliegergriff. Das Baby liegt mit seinem Bauch auf dem Unterarm. Der leichte Druck, der so auf den Magen-Darm-Trakt ausgelöst wird, kann Linderung verschaffen.
- Den Babybauch mit leichtem Druck massieren. Wichtig: Immer im Uhrzeigersinn, sonst arbeitet man gegen den Darm.
- Nach dem Essen das Baby nicht sofort hinlegen
- Ein leicht erwärmtes Kirschensteinkissen verwenden.
- Das Baby ins Tragetuch oder Bonding nehmen.
Wir freuen uns über Ihre Kommentare zum Beitrag!
Weitere Beiträge
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Patientenporträt: Leben ohne Nieren
Judith Rafael Rosa, 63, musste wegen einer Erbkrankheit ihre Nieren entfernen lassen. Vertrauen zum Arzt und die Aufforderung, sich jederzeit melden zu dürfen, gaben ihr beim Austritt Sicherheit.
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Patientenporträt Claudia Ruther
Claudia Ruther, 52, hatte Glück im Unglück, da ihr Brustkrebs keine Metastasen bildete. Heute ist sie krebsfrei und denkt sogar gerne an die Zeit im Onkologiezentrum zurück.
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Vom Spital bis zur Spitex
Die beste Versorgung im Spital nützt wenig, wenn die notwendige Nachsorge nach dem Spitalaustritt schlecht oder gar nicht organisiert wurde. Fünf Sichtweisen, wie eine gute Übergabe geplant sein soll.
Detail versessen und kompromisslos

Chirurgie
Detail versessen und kompromisslos
Wie war der erste Schnitt? Welche Fertigkeiten muss eine Chirurgin, ein Chirurg haben? Wohin führt der Trend zur Spezialisierung? Antworten im Gespräch mit Dr. med. Philippe Glauser, Chefarzt Chirurgie Spital Dornach.
Philippe Glauser, was ist das Attraktive an der Allgemein- und Viszeralchirurgie?
Das breite Spektrum macht diese beiden Fächer sehr interessant. Im Gegensatz zu einem Spezialisten operieren Sie nicht jeden Tag dasselbe Organ, sondern haben zahlreiche Herausforderungen. Dank der Allgemein-, aber auch dank der Spezialchirurgie können wir am Spital Dornach rund 70 Prozent aller Operationen abdecken.
In der Chirurgie gibt es den Trend zur Spezialisierung. Ist das gut oder schlecht?
Ich glaube, es ist sinnvoll, dass bei sehr seltenen Eingriffen eine Mindestzahl festgelegt wird. Die Frage ist: Was ist eine gute Mindestzahl? Wir brauchen zum Beispiel keine Spezialistinnen oder Spezialisten für sehr häufige Eingriffe. Hingegen ergibt es durchaus Sinn, bei komplexen Ein- griffen wie Bauchspeicheldrüsenoperationen eine Mindestfallzahl vorzuschreiben. Man muss sich jedoch immer wieder fragen: Ergibt es Sinn, sich immer mehr auf ein einziges Organ oder auf eine einzige Erkrankung festzulegen?
Welche Eigenschaften muss eine angehende Chirurgin, ein angehender Chirurg haben?
Ich glaube man muss detailversessen und kompromisslos sein. Auch wenn Sie etwas schon hundertmal gemacht haben, dürfen Sie nie nachlassen. Sie müssen einen Eingriff hundert Mal in derselben Tonqualität durchfuhren. Die akute Behandlung ist erst dann beendet, wenn die Patientin, der Patient wieder zu Hause ist. Sich wahrend eines Eingriffs mehrere Stunden lang hundertprozentig fokussieren zu können, fallt nicht allen jungen Chirurginnen und Chirurgen einfach. Aber man kann es lernen. Braucht es eine hohe Fingerfertigkeit? Man sollte nicht gerade zwei linke Hände haben. Aber die Sache mit den magischen Händen, das ist Hollywood. Chirurgie ist zu einem guten Stück auch Handwerk und auch das kann gelernt werden.
Chirurgen, sagt man manchmal, seien nicht die begnadeten Kommunikatoren? Für mich ist es keine Frage, dass man auch kommunizieren können muss. Am Ende geht es darum, dass wir eine vernünftige Medizin machen. Nicht jedes Resultat bei einem Eingriff lasst sich exakt voraussagen. Deshalb müssen wir herausfinden, was die Patientin oder der Patient mochte. Diese Entscheidung sollten wir immer zusammen mit den Patienten fallen – und dafür braucht es ein Gespür für Menschen.
Wie schätzen Sie das chirurgische Niveau der Schweiz ein?
Sehr hoch. Und ich hoffe, dass es so hoch bleibt. Was mir Sorgen bereitet, ist der fehlende Nachwuchs in der Allgemeinchirurgie. Auch wir spuren den Trend, dass viele Arztinnen und Arzte in ein Spezialgebiet wechseln mochten. Genauso wie wir eine gute Hausarztmedizin brauchen, brauchen wir auch gute Allgemeinchirurginnen und -chirurgen.
Können Sie sich an Ihren ersten Schnitt erinnern?
Den vergisst man nicht. Ich war erstaunt, wie fest man drucken muss, damit man durch die Hautoberflache kommt. Ich sehe dasselbe heute bei unseren Assistenzarztinnen und -arzten. Beim ersten Schnitt ritzen die meisten nur an der Oberflache.
Über Dr. med. Philippe Glauser

Dr. med. Philippe Glauser ist Facharzt für Viszeral-, Allgemein- und Unfallchirurgie und Chefarzt Viszeralchirurgie und Traumatologie, Spital Dornach.
Wir freuen uns über Ihre Kommentare zum Beitrag!
Weitere Beiträge
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Vernetzte Zusammenarbeit Ergotherapie
In der Ergotherapie ist es unser Ziel, dass die Patientinnen und Patienten möglichst viele Aktivitäten wieder ausführen können.
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Vernetzte Zusammenarbeit Orthopädie
Mit den heutigen Operationstechniken sind Patientinnen und Patienten viel rascher mobil als noch vor zehn, zwanzig Jahren.
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Kinder- und Jugendpsychiatrie
Es spricht vieles dafür, manche Kinder oder Jugendliche zu Hause und nicht in einem Besprechungszimmer oder in der Tagesklinik zu behandeln. Auf Hausbesuch im Wasseramt.
Patientengeschichte

Patientengeschichte
«Meine Endometriose wurde per Zufall entdeckt.»
Astrid Zeltner, 30, hatte schon früh immer wieder sehr starke Regelschmerzen. Ihre Endometriose wurde per Zufall entdeckt.
«Ich war 15 Jahre alt, als ich sehr starke Schmerzen während der Menstruation bekam. Ich hatte keine Ahnung, dass es die Krankheit Endometriose überhaupt gibt. Viele Ärzte offenbar auch nicht. Jahrelang hiess es, das sei normal, bei manchen Frauen sei der Regelschmerz stärker als bei anderen. Während der Arbeit blieb ich vor Schmerzen manchmal eine halbe Stunde mit Wärmekissen in einer Ecke sitzen, weil ichs kaum ausgehalten habe.
Als ich 21 Jahre alt war, hatte ich nebst den Schmerzen plötzlich auch Fieber. Mein damaliger Hausarzt in der Ostschweiz schickte mich sofort mit Verdacht auf geplatzten Blinddarm in den Notfall, wo sie mir den Blinddarm entfernten. Der war aber weder entzündet noch geplatzt. Also haben sie weiter nach Ursachen gesucht und Endometriose diagnostiziert. Die Endometriose-Herde wurden in derselben Operation gleich entfernt.
Danach ging es mir richtig gut. Ich konnte wieder uneingeschränkt Sport treiben, hatte Freiheiten und musste keine Medikamente mehr nehmen. Leider nur zwei, drei Jahre lang. Danach kamen die Schmerzen erneut. Luana kam zur Welt, danach Malea und heute habe ich wieder Einschränkungen. Mit den Kindern fühlt es sich aufgrund der andauernden Müdigkeit, welche die Krankheit mit sich führen kann, noch intensiver an.
Während der Menstruation sind die Schmerzen so stark, dass ich liegen muss. Meine Mutter und Schwiegermutter unterstützen uns glücklicherweise. Hormontherapie, Schmerzmedikamente – ich habe fast alles ausprobiert. Hormone vertrage ich schlecht. Ich versuche es nun mit komplementären Methoden, versuche auf meine Ernährung zu achten, gehe in die Massage und mache Sport, so gut es geht. Wenn die Kinder etwas grösser sind, kommt auch ein operativer Eingriff wieder in Frage. Vorher nicht.
Es ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass das Thema Endometriose in den Fokus rückt – vor allem wenn ich dran denke, wie lange meine Schmerzen nicht ernst genommen wurden.»
Wir freuen uns über Ihre Kommentare zum Beitrag!
Weitere Beiträge
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Patientenporträt Claudia Ruther
Claudia Ruther, 52, hatte Glück im Unglück, da ihr Brustkrebs keine Metastasen bildete. Heute ist sie krebsfrei und denkt sogar gerne an die Zeit im Onkologiezentrum zurück.
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Überlastung in der Notfallmedizin
Wie könnte die Notfallmedizin der Zukunft aussehen, darüber wird im Podcast gesprochen.
Spitalaustritt – Der Weg nach Hause
Vom Spital bis zur Spitex
Die beste Versorgung im Spital nützt wenig, wenn die notwendige Nachsorge nach dem Spitalaustritt schlecht oder gar nicht organisiert wurde. Fünf Sichtweisen, wie eine gute Übergabe geplant sein soll.





























